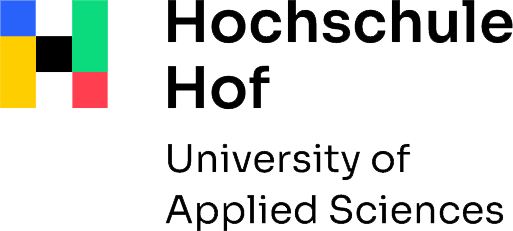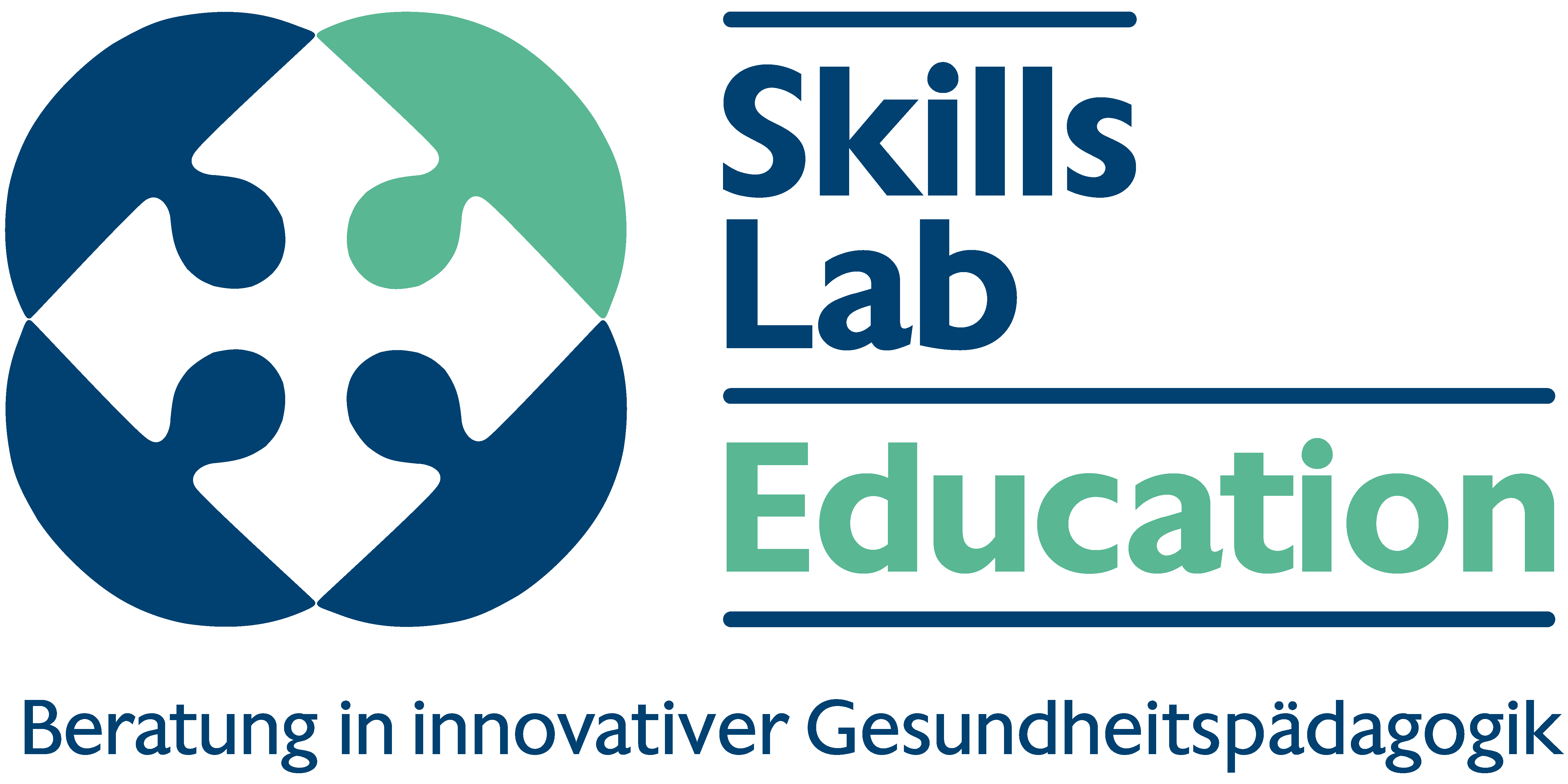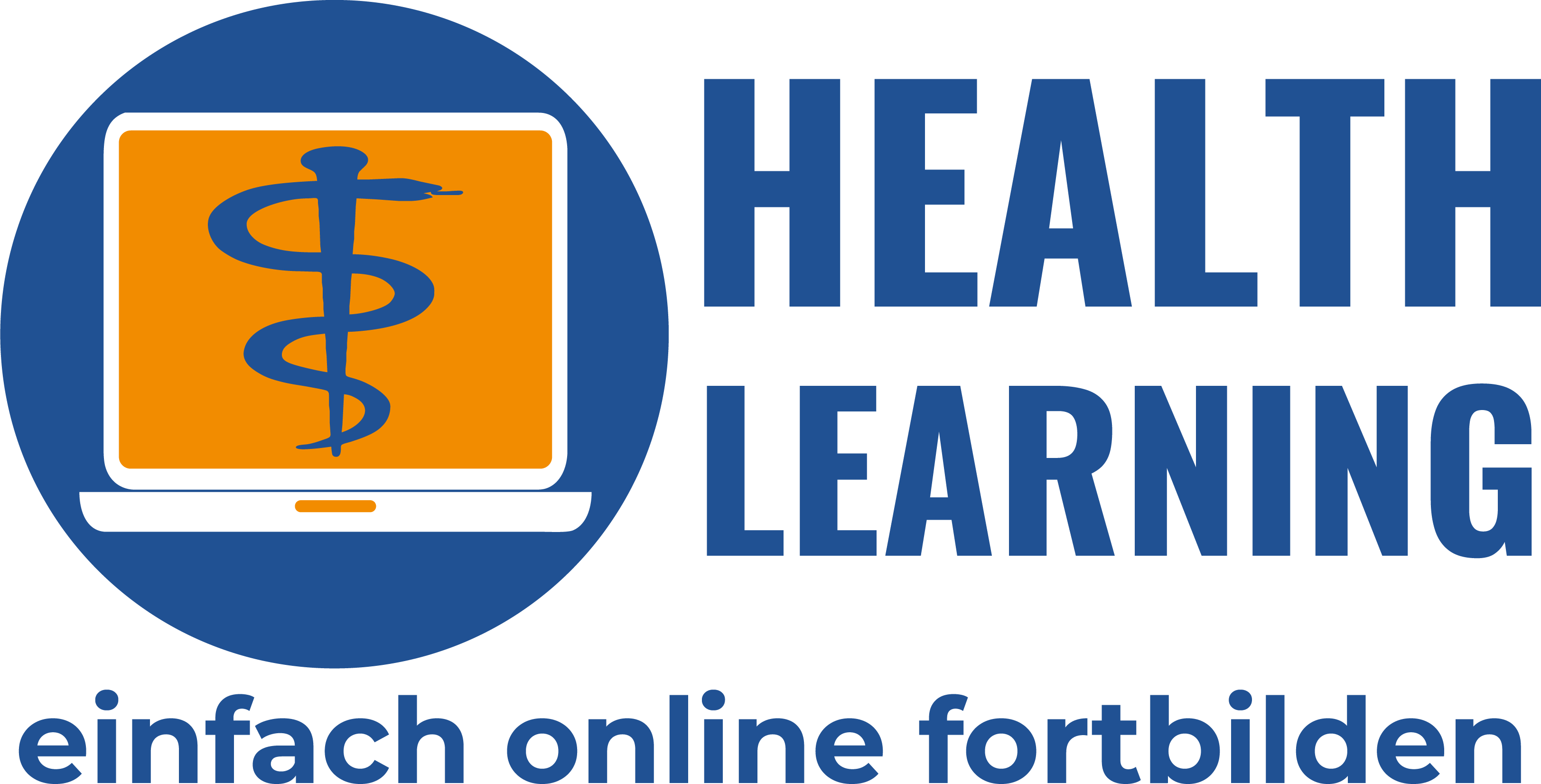Einleitung
Pflegende mit im Ausland erworbener Pflegequalifikation sind in der Pflegewelt längst kein Sonderfall mehr, sondern zählen zur Normalität des beruflichen Alltags. Dennoch bleibt die Migration in die Pflege ein kontroverses, wiederkehrendes Thema zahlreicher Debatten.
Während des Integrationsprozesses in den Pflegeberuf obliegt der beruflichen Bildung eine besondere Aufgabe: Lehrerinnen und Lehrer an Berufs- sowie Hochschulen und anleitende Personen in der Berufspraxis sind gefordert, die internationalen Pflegenden während dieser Zeit zu begleiten. Erschwerend ist, dass die Erfahrungswelten der Zugezogenen sowie ihre internationale Expertise jedoch bisher größtenteils einen blinden Fleck in der pflegebezogenen Berufsforschung und Pflegewissenschaft darstellen.
Future Skills, insbesondere hinsichtlich Digitalisierung und Vielfalt, können für den Integrationsprozess als große Chance gedeutet werden, um den Blick von Problembehaftung zu ressourcenorientierter Einbindung, Weiterentwicklung und Innovation zu lenken.
Hintergrund und Zielsetzung
Diesem Beitrag liegt die Dissertationsschrift Wie die Migration von Pflegekräften mit im Ausland erworbener Berufsqualifikation die Pflegeberufe in Deutschland verändert – Wechselwirkungen zwischen den Berufsauffassungen der Zugezogenen und der kollektiven Rollenzuschreibung der Pflegeberufe (Hubenthal, 2021) zugrunde.
Die Studie setzt an der Stelle an, dass für den Eintritt in den Pflegeberuf in Deutschland durch Leistungen wie Onboarding-Programme oder Integrationskurse eine monolaterale Anpassungsleistung in bestehende Verhältnisse festgelegt ist. Dennoch stellen Pflegende mit im Ausland erworbener Berufsqualifikation durch ihre bisher gebildete berufliche Identität, also ihre mitgebrachten Rollenauffassungen und verschiedene berufsbezogene Erfahrungen, die im Ankunftsland geltenden Tätigkeitschwerpunkte in Frage.
Folgende Fragestellungen bearbeitet der PreContent in diesem Zusammenhang: Welche Erfahrungen sammeln Pflegende mit im Ausland erworbener Berufsqualifikation in Bezug auf die hier gültigen Rollenbilder? Wie passen an sie adressierte Handlungserwartungen zu ihren eigenen Pflegeverständnissen? Wie können Future Skills dazu beitragen, die Integration von internationalen Pflegenden zu unterstützen?
Methoden
Um die Perspektive Pflegender mit im Ausland erworbener Berufsqualifikation und ihre Erfahrungen im Pflegeberuf in Deutschland in den Mittelpunkt der Forschung zu stellen, liegt der Studie ein qualitatives Forschungsdesign zugrunde. Mit internationalen Pflegenden, die zum Zeitpunkt der Erhebung (2018) mindestens ein Jahr in Deutschland arbeiteten, wurden problemzentrierte Interviews nach Witzel und Reiter (2012) geführt. Ausgewertet wurden diese mit der interpretativen phänomenologischen Analyse nach Smith (1996). So konnten neben Insidereinblicken in die Erfahrungswelten der Befragten auch abstraktere Outsiderpositionen erlangt werden.
Ergebnisse
Die Studie macht transparent, dass den befragten internationalen Pflegenden in den Kliniken und Altenpflegeeinrichtungen in Deutschland eine strenge Aufgabenverteilung und eine stark strukturierende sowie verbindliche Arbeitsorganisation begegnen. Dennoch wird wiederkehrend nach gemeingültigen Standards gesucht, um verlässliche Orientierung zu finden.
Die Befragten sehen sich vor die Aufgabe gestellt, die ihnen fremden Partizipationsbezüge kennenzulernen und an sie adressierte Handlungserwartungen zu erfüllen. Da die Arbeit in Deutschland kaum den Schwerpunkten der Herkunftsländer ähnelt, müssen sie ihre bisher vertrauten beruflichen Rollen aufgeben. Dies führt mehrheitlich zu Verunsicherung in der eigenen beruflichen Identität, da kaum auf vorhandene Kompetenzen und Wissensbestände zurückgegriffen werden kann. Auch entsteht Ernüchterung, weil die Befragten gefordert sind, sich im Team unterzuordnen und so ihre mitgebrachten Wissensbestände und Fähigkeiten in Form von anderen Erfahrungswerten, Ideen und Potenzialen für aufnehmende Teams ungenutzt bleiben.
Daher stellt sich die Frage nach einer inklusiven beruflichen Identität: Wie können also etablierte Denkmuster in Bezug auf kulturelle Unterschiede und auch über eine einseitige Anpassungsrichtung und teils hierarchische Überzeugungen aufgebrochen werden? Und wie kann in der Pflegepraxis eine Grundlage geschaffen werden, die dazu beitragen kann, ein universales Pflegeverständnis zu fördern?
Diskussion und Ausblick
An dieser Stelle werden Future Skills bedeutsam – auch, damit den Pflegeteams nicht das Potential entgeht, dass internationale Pflegende neben dem Quick-Fix des Fachkräftemangels in den Pflegeberuf miteinbringen können.
Zwar deuten aktuelle Entwicklungen darauf hin, dass sich Verantwortliche verschiedener Unternehmen immer häufiger darum bemühen, sich interkulturell aufzustellen, dennoch ist bislang weitgehend unbekannt, welche praktischen Umsetzungen aus diesen Tendenzen resultieren.
Um internationalen Pflegenden Orientierung zu geben und um auf ein allgemein gültiges Pflegeverständnis zu verweisen, mit welchem sich alle Pflegenden losgelöst ihrer Nationalität identifizieren können, ist aus Sicht der Autorin unbedingt ein einheitliches Verständnis über die pflegerischen Relevanzsetzungen notwendig. Dieses verbindende Element kann Transparenz über das pflegerische Tun ermöglichen und damit auch theoretische Konstrukte wie Pflege- und Rollenverständnis in praktische Beispiele übersetzen.
Großen Gewinn können hier international bekannte Pflegeklassifikationssysteme bringen, indem sie die Pflegeprozessgestaltung sowie die Entscheidungsfindungsprozesse bezüglich pflegerischer Interventionen nach pflegewissenschaftlichen Kriterien unterstützen. Durch die Nutzung von Klassifikationssystemen können also in der Praxis eher abstrakte Handlungserwartungen in gemeingültige, standardisierte und evidente Pflegeinterventionen übersetzt werden. Dadurch entsteht das Potential, sich unterscheidende Annahmen zu Pflegesituationen schrittweise zu identifizieren, dadurch etablierte Muster zu reflektieren, diese durch wissenschaftliche Erkenntnisse zu prüfen, sodass Raum für neue gemeinsam erarbeitete und wissenschaftlich geprüfte Handlungsroutinen entstehen kann.
Digitalisierung und damit verbundenen Future Skills kommen hierbei eine besondere Bedeutung zu. Digitale Tools, die Pflegefachsprachen abbilden bringen neben dem Nutzen mit, dass sie in mehrere Sprachen übersetzen können und dass sie besonders anschaulich sind, dass sie überall auf der Welt Verbreitung und Zuspruch erfahren. Sie bieten also die Chance von Wiedererkennung und Verbindung und können bei entsprechender Anwendung ein Instrument zur Gestaltung einer inklusiven Pflegewelt darstellen.
Literatur
- Hubenthal, N. (2021). Wie die Migration von Pflegekräften mit im Ausland erworbener Berufsqualifikation die Pflegeberufe in Deutschland verändert. Wechselwirkungen zwischen Berufsauffassungen der Zugezogenen und der kollektiven Rollenzuschreibung der Pflegeberufe. Kassel: kassel university press.
- Smith, J. A. (1996). Beyond the divide between cognition and discourse: Using interpretative phenomenological analysis in health psychology. Psychology & Health, Nr. 2/11, 261–271.
- Witzel, A. & Reiter, H. (2012). The Problem-centred Interview. Principles and Practice. Los Angeles [u. a.]: SAGE.